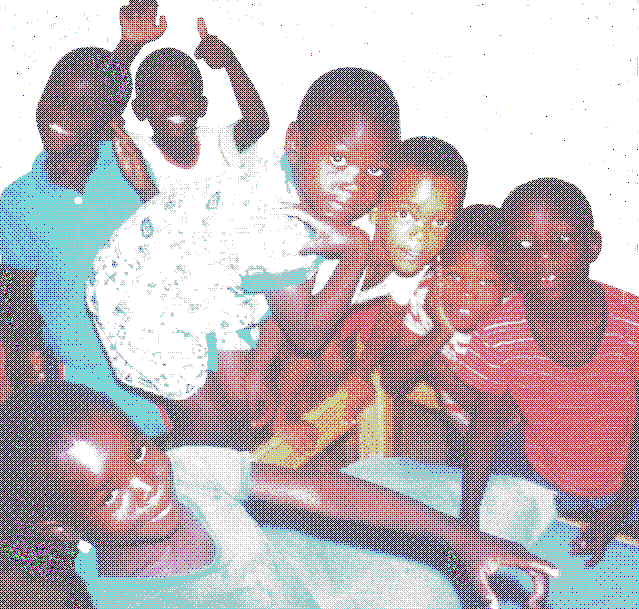Afrikas letzte Cowboys
Traumhochzeit mit einer Toten home
Originalmanuskript DIE ZEIT Nr. 13 - 22. März 1991
© Jürgen Duenbostel
Namibia nach der Unabhängigkeit.
Das Umdenken macht Mühe und
die "Helden"
des Kriegs gegen die Besatzer sind enttäuscht.
"Ist das die Freiheit,
für die wir gekämpft
haben?"
Von Jürgen Duenbostel
|
Im Rollstuhl sind es bis "Las Vegas" fünf
Minuten. Geld kann man dort zwar nicht gewinnen,
aber Karten spielen und knobeln, trinken und vom
großen Glück träumen - und vor allem vergessen.
Vergessen, daß der Mitspieler auf der anderen
Seite gekämpft hat. Auf der Seite, von der die
Granate kam, die den Rollstuhlfahrer für den Rest
seines Lebens zum Helden und Krüppel gemacht hat.
Nachtclub nennt sich der schlichte Blechdach-Bau
mit dem von der Spieler-Stadt geborgten Namen.
Eigentlich ist es die übliche "Bar & Bottle
Store"- Kombination. Aber die scheppernd
dröhnende Musik aus den Lautsprechern wirkt wie
ein Magnet auf die kriegsversehrten Veteranen aus
dem benachbarten Hospital. Schließlich gibt es
für sie nicht viel Abwechslung hier in Oshakati,
der Bezirkshauptstadt von Namibias Ovamboland.
|
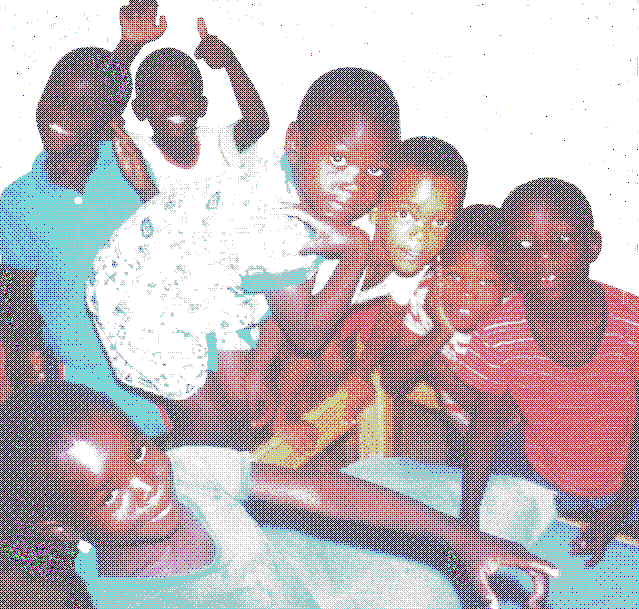
Wie wird die Zukunft
für Namibias
Kinder aussehen?
Foto:Jürgen
Duenbostel |
Ab
und an allerdings, wenn sie einmal besser bei
Kasse sind, lenken sie ihren Rollstuhl oder
humpeln sie auf ihren Krücken auch zur Bar des
"International Guest-House", dem einzigen Hotel
guten Standards in der Region. Sie passieren
dabei jenes inzwischen verrostete Tor mit dem
verlassenen Wachhäuschen, wo früher Schwarzen der
Zutritt verwehrt wurde. Dahinter liegt, hoch
umzäunt, das bessere Viertel. Immer noch wohnen
hier die Weißen. Es sind Beamte aus der
Verwaltung und vielfach ehemalige Angehörige der
südafrikanischen Armee. Die Sandsäcke aus der
Kriegszeit nutzen sie jetzt zur Umrandung ihrer
Blumenbeete.

Truppen der einstigen
PLAN beim Manöver
|
Gelangweilt vertreiben sich die schwarzen
Barkeeper und Kellner mit Knobeln die Zeit. Es
gibt kaum noch Gäste im "Guest-House". Seit die
südafrikanische Armee und die UNCTAD-Truppen der
Vereinten Nationen abgezogen sind, ist der Bier-
und Beefsteak-Boom im Norden Namibias vorbei.
Auch in den Läden sind die Umsätze drastisch
gesunken. Hochgeschnellt sind die
Arbeitslosenzahlen. Und Diebstähle, Einbrüche und
Überfälle nehmen Überhand. "Aus
Sicherheitsgründen" haben deshalb viele weiße
Ärzte und Apotheker dem Norden den Rücken
gekehrt. Die medizinische Versorgung beginnt
bereits kritisch zu werden. Im Krieg hatten sie
sich offenbar sicherer gefühlt. Oder ist der
Hauptgrund ihrer Landflucht die neue Politik, daß
weiße Mediziner hier nicht mehr besser bezahlt
werden als schwarze?
|
Es ist - fast ein Jahr nach der Unabhängigkeit -
eine heikle Aufgabe für die namibische Regierung,
die weißen Fachkräfte, auf die das Land noch
lange angewiesen sein wird, bei der Stange zu
halten und gleichzeitig die Masse der Wähler
nicht vor den Kopf zu stoßen. Letztere haben in
die Unabhängigkeit große Erwartungen gesetzt, zu
große vielleicht. Schon macht sich bei Anhängern
der SWAPO, insbesondere den ehemaligen Soldaten
der PLAN, der "Volksbefreiungsarmee Namibias",
Enttäuschung breit. "Ist das die Freiheit, für
die wir gekämpft haben?", fragen viele, die noch
immer auf einen Job warten. Sie hatten gehofft,
vielleicht mit einem Stück Land, einem Häuschen
oder einem Posten in der Regierung oder
Verwaltung belohnt zu werden.
Aber solange weiße Farmer ihr Land nicht
verkaufen, kann die Regierung nur neues Land zur
Zuteilung urbar machen. Und das kostet Geld und
Zeit. Und selbst wenn die Weißen verkaufen, mag
eine Zerstückelung der Flächen ökologisch riskant
sein und den Neubauern kaum zum Überleben
reichen. Denn die Agrarpreise sind schlechter
geworden. Im Jahr 1972 konnte ein Farmer noch für
den Erlös von vier Rindern einen "Bakkie", einen
Pritschenwagen erstehen. Heute muß er für solch
einen Kleinlastwagen schon 40 Rinder verkaufen.
Mit dem Arbeitsangebot im Öffentlichentlichen
Dienst sieht es auch nicht rosiger aus. Zum einen
gibt es aus den Reihen der PLAN-Veteranen nicht
genügend gut ausgebildete Kräfte. Zum andern sind
in der Verwaltung keine Stellen frei. Die
Regierung mußte fast die gesamte, noch aus der
Apartheidszeit stammende, aufgeblähte Bürokratie
übernehmen, um den Frieden und die Versöhnung
nicht zu gefährden. Denn Versöhnung ist das
wichtigste für die Zukunft des jungen Staates.
Wohl kaum jemand hatte erwartet, daß die neue
Regierung diese Politik so konsequent und
nachdrücklich verfolgen würde. Was in der
Vergangenheit geschehen sei, müsse "vergeben und
vergessen" werden, fordert Präsident Sam Nujoma
seine Landsleute wieder und wieder auf. Die
meisten geben sich redlich Mühe, das zu
beherzigen. "Es ist nicht leicht, den Wunsch nach
Rache zu unterdrücken, aber ich kann ihnen
vergeben", meint Simon Ndakewa, der einst von der
berüchtigten Einheit Koevoet (=Brechstange)
gefangen und gequält wurde und jetzt gelegentlich
auf Oshakatis Hauptstraße seinen damaligen
Folterer wiedersieht. Auch in der neuen Armee
funktioniert offenbar die Integration. Je zur
Hälfte ist sie aus ehemalige PLAN-Kämpfern und
deren früheren Gegnern zusammengesetzt, den
Soldaten der SWATF, der von Südafrika
geschaffenen Südwestafrikanischen
Territorialstreitkräfte.
Manchmal scheint das Vergessen allerdings zu weit
zu gehen. So stieß die Ernennung von Solomon
"Jesus" Hawala zum Armeekommandeur, dem
dritthöchsten Posten der Streitkräfte, auf
heftige Kritik. Als Sicherheitschef der SWAPO und
Leiter des Geheimdienstes der PLAN hatte sich
Hawala wegen seiner Grausamkeiten gegen
vermeintliche Spione in eigenen Reihen den
Beinamen "der Schlächter von Lubango" zugezogen.
Andere, denen die Brutalität burischer Polizisten
noch in frischer Erinnerung ist, hat ebenso
befremdet, daß ausgerechnet ein Bure, der
Generalmajor Piet Fouche, zum ersten Polizeichef
Namibias gemacht wurde. Aber vielleicht wäre die
junge Nation schon im ersten Jahr gescheitert,
wenn man begonnen hätte, vergangene Taten
gegeneinander aufzurechnen.
Auf Dauer, so meint Immanuel Dumeni, Direktor des
Komitees des namibischen Kirchenrats für
Wiedereingliederung der Flüchtlinge und
Wiederaufbau, auf Dauer sei jedoch mehr nötig,
damit die Leute im Lande im Frieden miteinander
leben: "Eventuell muß die Losung von Versöhnung
langsam durch Worte abgelöst werden wie
Gerechtigkeit, Gleichheit, Verbesserung des
Lebensstandards und Ausgleich des regionalen
Gefälles. Ich glaube, bislang ist die Lage noch
unter Kontrolle, und was getan wurde, ist meiner
Meinung nach das Beste, was getan werden konnte.
Aber ich meine, daß jetzt die Zeit gekommen ist,
anzufangen, für mehr Gerechtigkeit zu arbeiten,
für Gleichheit und besseres Leben und für
Arbeitsplätze für die Masse der Namibianer."
Der bessere Lebensstandard wird aber noch auf
sich warten lassen. Denn wie Südafrika, mit
dessen Wirtschaft das Land noch eng verflochten
ist, schlitterte Namibia Anfang vergangenen
Jahres in eine Rezession - just zu Beginn der
Unabhängigkeit. Wahrscheinlich werden noch zwei
Jahre vergehen, bis es zu einer wirtschaftlichen
Erholung kommt. Erst dann kann
Wirtschaftswachstum den bisher Benachteiligten
zugute kommen. Nicht solange zu warten und den
vorhandenen Besitz sofort drastisch
umzuverteilen, kann sich die Regierung nicht
leisten. Dann nämlich würde sie die weißen
Fachleute verschrecken, deren Kenntnisse zum
Aufbau der Nation noch unentbehrlich sind.
Schließlich kontrollieren die Weißen, die nur
sieben Prozent der 1,7 Millionen Einwohner
Namibias ausmachen, noch 80 Prozent der
Produktion. Zwar hat die Regierung gleich im
ersten Budget die Bildungsausgaben kräftig erhöht
- ein Viertel des Haushalts ist für Bildung und
Ausbildung reserviert -, aber nach vielen
Jahrzehnten südafrikanischer Bantu-Erziehung wird
es Generationen dauern, bis der
Ausbildungsrückstand aufgeholt ist.
So wird bei vielen Stellenbesetzungen immer noch
Weißen der Vorzug gegeben. Das mag gar nicht
Rassismus sein, sondern schlicht daran liegen,
daß es keine schwarzen Bewerber mit den nötigen
Qualifikationen gibt. Oft ist allerdings auch die
Furcht ausschlaggebend, daß ein schwarzer
Bewerber aus dem Norden ein
"Gewerkschaftsagitator" sein könnte. Zu sehr ist
das alte Denken in den Köpfen der Weißen
verankert. Sie haben noch nicht akzeptiert, daß
zu einer Demokratie auch ein neues, soziales
Arbeitsrecht gehört. Und so mancher Großfarmer
hält es noch für ausreichend, wenn er seine
"Kaffern" mit Mais, Bohnen und Hirse versorgt und
ihnen von Zeit zu Zeit eine Kudu-Antilope als
Fleischration schießt. Die Regierung hat den
Farmern jetzt eine Drei-Jahres-Frist gegeben,
freiwillig die sozialen Bedingungen ihrer
Arbeitskräfte zu verbessern. Wenn in dieser Zeit
nichts geschieht, soll ein um so schärferes
Arbeitsrecht in der Landwirtschaft verabschiedet
werden.
Allerdings haben auch schwarze Geschäftsleute
keine Neigung - und vielleicht auch kein Geld -
für soziale Gesten. Die namibische Gewerkschaft
für Beschäftigte der Lebensmittelbranche (Nafau)
klagt, daß Arbeiter, die von schwarzen
Unternehmern beschäftigt werden, noch schlechter
bezahlt werden, länger arbeiten müssen und keine
Sozialleistungen wie Altersversorgungs- oder
Krankenversicherungszuschüsse erhalten.
Andererseits haben manche Namibianer auch falsche
Vorstellungen von den Freiheiten der neuen
Unabhängigkeit. Im Ovamboland etwa zahlen die
Leute ihre Strom- und Wasserrechnungen nicht
mehr, weil jetzt ja ihre Regierung an der Macht
ist. In vielen Betrieben ist der "Schwund"
sprunghaft angestiegen. Die Leute lassen
mitgehen, was sie zu Hause gut gebrauchen oder
verhökern können. Weiße Meister und Vorarbeiter
schauen weg nach dem Motto: die Kaffern werden
schon sehen, was sie davon haben.
Ministerpräsident Hage Geingob sah sich an seinem
Arbeitsplatz in Windhoek selbst schon mit solchem
Mentalitätsproblem konfrontiert: "Bislang waren
die Schwarzen gezwungen, für Weiße zu arbeiten.
Aber jetzt glaubt selbst das Reinigungspersonal
hier im Regierungsgebäude, weil jetzt Schwarze
regieren, könnten sie gammeln."
Die farbige Kellnerin im "Cafe Anton" jedoch,
beim "Hotel Schweizer Haus" in Swakopmund, ist
sehr fleißig. Sie spricht fließend deutsch, so
wie es die überwiegend deutschstämmige und
deutsche Kundschaft in diesem Seebad aus der
Kaiserzeit erwartet. Man ist hier fast wieder
unter sich, seit die Buren in "Südwest" nicht
mehr das Sagen haben. Auch der palmenumsäumte
Rasen des gegenüberliegenden State House ist
wieder ordentlich und sauber. Wie hatte es doch
die Leute aufgeregt, als dort im Dezember und
Januar schwarze Soldaten kampierten. Der neue
Präsident hatte sie als Leibgarde mitgebracht,
als er in in jenen Tagen, wo es in Windhoek heiß
und an der Küste angenehm kühl ist, seinen
Sommerurlaub in Swakopmund verbrachte.

Feuerwehr in
Lüderitz |
Furchterregend war das schon. Noch heute ist es
Tagesgespräch, daß die Garde einen Deutschen
Schäferhund erschossen hat. Dabei war der Hund
aus dem Diplomatenviertel Klein-Windhoek völlig
unschuldig. Er war einfach gewohnt, Schwarze
bisssig anzubellen. Doch Namibia ist ein
Rechtsstaat. Mitglieder der Präsidentengarde
erhielten einen Haftbefehl wegen Mordversuchs.
Nicht wegen des Hundes, sondern weil sie auch
einen weißen Farmer ins Bein geschossen hatten,
der der Blaulichkolonne des Präsidenten nicht
rechtzeitig den Weg freigemacht hatte. |
Vielen
Weißen fällt es wohl auch immer noch schwer,
Platz zu machen, wenn schwarze Posten das für
einen "Kaffern-Präsidenten" verlangen. Und die
Soldaten der Garde, noch unsicher in ihrer neuen
Aufgabe, reagieren leicht überreizt.
Aber jetzt ist der Präsident wieder weit weg in
Windhoek. Und die Kaiser Wilhelm Straße in
Swakopmund heißt immer noch Kaiser Wilhelm
Straße, die Moltke Straße noch Moltke Straße, der
rot-weiße Leuchtturm steht auch noch und das
Hansa-Bier schmeckt weiter so wie früher.
Es bedurfte einst schon deutschen
Einfallsreichtums, ausgerechnet hier in
Swakopmund eine Brauerei zu gründen. Denn der
allmorgendliche Nebel, der vom kalten Benguela-
Meeresstrom herüberzieht und die gelb-graue
Namib-Wüste benetzt, ist die einzig natürliche
Quelle von Feuchtigkeit. Nur Tiefbrunnen, die
Grundwasser unter dem fast immer trockenen
Swakopfluß fördern, und inzwischen auch eine
Meerwasserentsalzungsanlage, bringen zusätzliches
kostbares Naß. Aber "Bier aus dem Durstland" ist
ein bis heute erfolgreicher Werbespruch.
Die deutschen Brauer, die in der Eckkneipe der
Hansa-Brauerei nach Feierabend noch ein paar
Schoppen Freibier trinken, sprechen eigentlich
ganz freundlich über ihre Kollegen, "die
Kaffern"; die allerdings gestern wieder einen
fatalen Fehler gemacht haben. Die doppelte Menge
Gärsud haben sie in den Tank gegeben. Hätten
nicht die deutschen Brauer mit ihrem Fachwissen
alles noch retten können....
Wie lange wird hier "Deutsch Südwest" noch
weiterleben?
Gerade dieser Reiz des lebendigen Kolonialmuseums
ist es jedoch, der die Touristen nach Swakopmund
zieht. Gut 30.000 kommen jährlich aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich nach
Namibia. Viele sind Verwandte und Bekannte von
deutschstämmigen "Südwestlern". Sie bringen
wichtige Devisen mit, die das Land für seine
Zukunft benötigt. Hanno Rumpf, Staatssekretär für
Natur, Umweltschutz und Tourismus, SWAPO-
Mitglied, weiß und deutschsprachig, will den
historischen Bezug zu Deutschland erhalten, um
die Besucher von dort nicht zu verlieren. Auch in
Südafrika wird geworben, um Urlauber von dort
zurückzugewinnen. Denn vor allem mit Geldern von
den Touristen muß das Ministerium den Umwelt- und
Naturschutz finanzieren.
Mit vermeintlichen Naturfreunden hatte Rumpf
allerdings schon erheblichen Ärger. Die
Koordinatorin der Gruppe "SOS" (Save our seals)
warf eine "Blut-Bome" aus Catchup in das Büro der
namibischen Tourismusbehörde, um gegen das Töten
von Seelöwen zu demonstrieren. Schon drohen
Aktionsgruppen mit einer internationalen
Boykottkampagne gegen Namibia. "Diese Gruppen
greifen das weltweit emotional aufgeheizte
Robben-Thema auf", kommentiert Hanno Rumpf, "ohne
zu differenzieren. In Namibia sind es andere
Robben als die in Kanada. Seit den späten
zwanziger Jahren werden Seelöwen hier geschlagen.
Und wissenschaftliche Zählungen haben ergeben,
daß sich ihre Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg
verdreifacht hat. Aber als Anfang der achtziger
Jahre keine Robben geschlagen wurden, spülte das
Meer tausende von verhungerten Robbenbabies bei
Lüderitz an. Das natürliche Gleichgewicht, das
diese Gruppen postulieren, ist durch menschliche
Eingriffe schon lange zerstört. Heute ist eine
kontrollierte Pflege solcher Ressourcen nötig.
Und die schafft zudem noch Arbeitsplätze."
Die Robbenbabies waren verhungert, weil
internationale Fischflotten in der Zeit der
südafrikanischen Besetzung des Landes schamlos
die Fischbestände vor der Küste geplündert haben.
Auch heute wildern noch fremde Fischer in
namibischen Gewässern. Zwar hat der jetzt
unabhängige Staat eine rechtlich gesicherte 200-
Meilen-Wirtschaftszone vor der Küste, aber noch
nicht genügend Patroillenboote und -hubschrauber,
um alle "Seeräuber" zu vertreiben. Der
Fischbestand erholt sich deshalb nur langsam. Vor
allem die Spanier, deren fischverarbeitende
Industrie in den verarmten Gebieten an der
spanischen Atlantik-Küste von Arbeitslosigkeit
bedroht ist, freibeutern fleißig weiter in
namibischen Gewässern. Im im November allerdings
gelang es der namibischen Küstenwache, fünf
spanische Fangschiffe nach Schüssen vor den Bug
zu entern und die Schiffe mit einer Fischladung
im Wert von fast sechs Millionen Dollar zu
beschlagnahmen. Namibias Außenminister Theo Ben
Gurirab warnte Spaniens Botschafter: "Das nächste
Mal müssen wir vielleicht schon über Tote reden."
Jetzt allerdings wird über eine
Fischverarbeitungsfabrik verhandelt, die Spanien
in Lüderitz errichten will. Namibia braucht
schließlich die Arbeitsplätze.
Wenn es gelingt, die Fischbestände völlig zu
regenerieren, dann könnte die Fischerei und
Fischverarbeitung zum wichtigsten
Wirtschaftsfaktor des Landes werden. Rund eine
Milliarde Dollar pro Jahr und jede Menge
Arbeitsplätze könnte die Fischerei dem Lande
einbringen. Auch der Seetank des Meeres soll
genutzt werden. Mit Hilfe von Aquakulturen will
Namibia chemische Grundstoffe daraus gewinnen.
Die traditionellen Minen können dem Land
ebenfalls noch einiges einbringen. Zwar sind die
Uranpreise gefallen und der Absatz von Rössings
Uranabbau ist zurückgegangen, aber die zum De
Beers Konzern gehörenden Consolidated Diamont
Mines investieren kräftig in die Erschließung
weiterer Diamantenvorkommen. Auch wurde im
vergangenen Jahr rund 200 Kilometer nordwestlich
von Windhoek bei Karibib das erste Goldbergwerk
des Landes eröffnet.
Darüberhinaus besteht die Chance, daß in Namibia
wie im benachbarten Angola Öl gefunden wird. Im
Norden des Landes, wo wegen des langen Krieges
vorher keine Erkundungen möglich waren, hat ein
Unternehmen aus Taiwan die Ölsuche aufgenommen.
Gerade in dieser Region, wo die Arbeitslosigkeit
am höchsten ist, sind Investoren hochwillkommen.
Aber weil hier außer der von den Südafrikanern
angelegten militärischen Rollbahn zur
angolanischen Grenze und der parallelen Wasser-
Pipeline kaum Infrastruktur vorhanden ist, zeigen
die Unternehmen noch wenig Interesse.
Das könnte sich aber ändern, wenn auch in Angola
die Unita-Rebellen jetzt endlich dauerhaften
Frieden mit der Regierung schließen. Dann nämlich
könnte von hier aus die Versorgung und der
Wiederaufbau der kriegszerstörten Gebiete Angolas
beginnen.
|
Insgesamt hat Namibia also auf lange Sicht wohl
wirtschaftlich bessere Chancen als die meisten
anderen afrikanischen Staaten. Doch zunächst
einmal wirken sich Investitionen steuermindernd
und damit negativ auf die Staatskasse aus.
"Geduld, Geduld" predigt deshalb die SWAPO ihren
Anhängern, die nicht begreifen wollen, daß es mit
Beginn der Unabhängigkeit zunächst einmal bergab
geht. Es wird schon einige Überzeugungskraft
erfordern, neuen Aufruhr zu verhindern. Die
nächsten zwei Jahre werden dabei die
entscheidenden sein. Wenn es der Regierung Nujoma
in dieser Zeit gelingt, das Wiederaufbrechen
alter Konflikte zu vermeiden und Schwarze wie
Weiße für aktive Mitarbeit beim Aufbau des neuen
Staates zu gewinnen, dann hat das Land eine gute
Chance für einen dauerhaften Frieden und stetigen
Anstieg des Lebensstandards.
Zunächst aber sind viele Namibianer vor allem
damit beschäftigt, wie sie die nächsten Wochen
und Monate über die Runden kommen. In Windhoek
steht ein junger Mann, ein Schwarzer, am "Robot",
an der Ampel. Wenn sie rot ist, ruft er den
Autofahrern, jedem einzeln, zu: "Ek soek vir
werk!",("Ich suche Arbeit!"). Er spricht
Afrikaans, denn die neue Amtsprache Englisch hat
er noch nicht gelernt. Ob wohl ein Afrikaaner ein
offenes Ohr für ihn hat und Bedarf an
Arbeitskraft dazu?
| 
Werden diese Schüler später einen Job bekommen?
Fotos: Jürgen Duenbostel
|
© Jürgen Duenbostel
next home